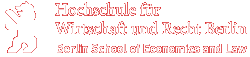Sie sind hier: Startseite
Modulbeschreibungen
| Modul-Titel (Original): | |||
|---|---|---|---|
| Prüfung | [332002] Europäisches Wirtschaftsrecht | Prüfungsform | [Ko] Kombinierte Prüfung |
| Studiengang | [ALL] LVn FB1 oder SG | Prüfungsart | [FP] Fachprüfung |
| Credits | 5 | Pflichtkennzeichen | [WP] Wahlpflichtfach |
| Modulverantwortliche/-r | Prof. Dr. Torsten Tristan Straub | ||
| Lerngebiet | Vertiefung Wirtschaftsrecht/Schwerpunkt: Kultur und Medien; Bank -und Restrukturierungsrecht; Digitale Wirtschaft in Europa; Arbeitsrecht und Personalsteuerung |
| Zielsetzung | Der Kurs verhilft den Studierenden zum Verständnis der Chancen und Risiken grenzüberschreitender Wirtschaftstransaktionen innerhalb des europäischen Binnenmarkts und über die Außengrenzen der Europäischen Union, insb. im Rahmen der WTO. |
| Lehrmethode | Seminaristischer Unterricht |
| Lehrinhalte | 1. Das auf Wirtschaftstransaktionen anwendbare Recht, insb. Internationales Privatrecht (der EU und Deutschlands) |
| Literatur | Empfehlungen zu Literatur und Recherche werden in der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. |
| Fachliche Voraussetzungen | Grundkenntnisse der juristischen Methoden, im Privaten Wirtschaftsrecht und im Unternehmensrecht (aus dem Ersten Studienabschnitt) |
| Lehrmethode und SWS | Seminaristischer Unterricht (4 SWS; Präsenzunterricht: 60h, Tag und Abend) |
| Lernergebnisse und Kompetenzen | LEG 1) Die Studierenden kennen die Bedingungen grenzüberschreitender Transaktionen von Wirtschaftsgütern innerhalb des Binnenmarktes der EU, aber auch über deren Außengrenzen hinaus im Rahmen der WTO. LEG 2) Die Studierenden haben ein Bewusstsein für die Unterschiede der eventuell maßgeblichen Rechtsordnungen und Verständnis für deren mehr oder weniger berechtigten rechts-, wirtschafts- und sozialpolitischen Belange (z.B. zum Schutz vor Diskriminierung und zum Verbraucher- oder Umweltschutz) entwickelt. LEG 3) Sie können einschätzen, welche Rechtsordnung infolge von Kollisionsnormen im konkreten Fall zur Anwendung kommen kann, und welche Rolle die europäische oder internationale Harmonisierung dabei spielt. LEG 4) Sie verstehen den Mechanismus von Mindeststandards und der gegenseitigen Anerkennung nationaler Rechtsunterschiede. LEG 5) Sie haben ihre Kenntnisse im juristischen Argumentieren anhand von Entscheidungen (insb. des Gerichtshof der EU, aber auch des DSB der WTO) vertieft und ihren Sinn für praktische Probleme de lege lata und de lege ferenda geschärft. LEG 6) Sie haben daraus die Fähigkeit entwickelt, bei konkreten europabezogenen Transaktionen drohende Hindernisse rechtlicher Art zu vermeiden, in aufgetretenen Konflikten eigene Standpunkte begründet zu vertreten oder einen Vorschlag zur Streitbeilegung zu entwerfen. |
| Verwendbarkeit des Moduls |
|
| Bemerkung | Überprüfung des Kompetenzerwerbs: In diesem Modul gibt es eine Kombinierte Prüfung. Sie besteht aus einem mündlichen Referat (40 %) und dessen schriftlicher Ausarbeitung (60 %), für die eine Gesamtnote erteilt wird. Zur jeweiligen Funktion und Inhalt des mündlichen und des schriftlichen Teils siehe unten Punkt 28. Das Referat (bzw. „Präsentation”) hat eine Vortragsdauer von ca. 20-35 Minuten. Die schriftliche Ausarbeitung entspricht einer kurzen Hausarbeit im Umfang von 2000 bis 3000 Wörtern. Die genannten Inhalte sowie die LEG 1-6 werden weniger abschnittsbezogen behandelt, als vielmehr problemorientiert von den Studierenden anhand von Fällen und typischen Konfliktsituationen erarbeitet und überprüft. Sie tun dies vertieft und eigenständig (wenngleich unter angebotener individueller Beratung durch den / die Lehrende/n) im Rahmen der kombinierten Prüfung, deren mündlichen Teil sie in einem Referat dem gesamten Kurs präsentieren und zur Diskussion stellen. Über die allgemeine aktive Teilnahme hinaus tragen sie dadurch in bedeutendem Maße zum Seminar bei und können Eigeninitiative fruchtbar machen (zumal sie selbst passende Themen vorschlagen dürfen). In der Regel wählen sie ein Rechtsproblem, das bei grenzüberschreitenden Transaktionen auftritt, illustrieren es anhand von realen Fällen und Gerichtsentscheidungen und arbeiten so typische Konfliktlagen heraus. Mithilfe einer Stakeholder-Analyse sind sie dann in der Lage, die betroffenen Interessen über die bloßen konkreten privaten Streitparteien hinaus zu erfassen (insb. evtl. Allgemeinwohlbelange). Dies wiederum hilft ihnen bei der Deutung, Gewichtung und Bewertung der im Rechtsstreit oder der Gesetzgebungsdebatte vorgebrachten (oder vorzubringenden) Argumente. All dies mündet in die Entwicklung eines eigenen Standpunkts zur Zweckmäßigkeit und Gerechtigkeit von Regelungen einerseits und zu Rechtsunterschieden bei der Vermeidung von Geschäftshindernissen bzw. zur Nutzung von Geschäftschancen andererseits. Im schriftlichen Teil der kombinierten Prüfung fassen sie die aus dem Vortrag und der Diskussion gewonnenen Erkenntnisse zusammen und profitieren von der Gelegenheit, Unklarheiten zu erhellen, Irrtümer zu berichtigen und Lücken zu ergänzen. |